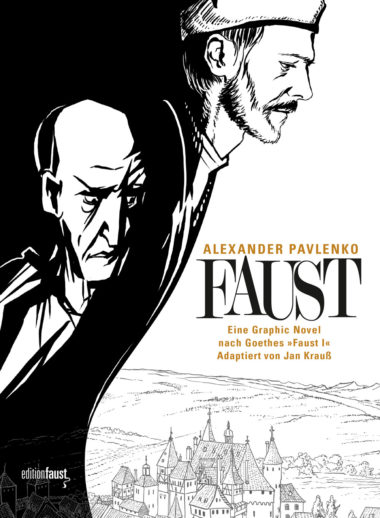2020 ist vorbei. Ein einziger Jahrmarkt der Seltsamkeiten. Nicht zum Vergessen, sondern eher ein Beleg dafür wie fragil unsere Existenz auf diesem Planeten ist. Immerhin ist die Kultur noch nicht tot, und das ist so verdammt wichtig, bereits, damit man die ganzen verwirrten Leerdenker dort draußen ausblenden kann. Jakob von Hoddis‘ „Weltende“ ist nah: „Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, In allen Lüften hallt es wie Geschrei.“ Lassen wir es nicht zu laut werden. Dagegen hilft:
2020 ist vorbei. Ein einziger Jahrmarkt der Seltsamkeiten. Nicht zum Vergessen, sondern eher ein Beleg dafür wie fragil unsere Existenz auf diesem Planeten ist. Immerhin ist die Kultur noch nicht tot, und das ist so verdammt wichtig, bereits, damit man die ganzen verwirrten Leerdenker dort draußen ausblenden kann. Jakob von Hoddis‘ „Weltende“ ist nah: „Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, In allen Lüften hallt es wie Geschrei.“ Lassen wir es nicht zu laut werden. Dagegen hilft:
Die Musik:
Jaume De Viala: Sonoritat De Mil Miralls. Mein Fazit bei Musikreviews.de: „„Sonoritat De Mil Miralls“ ist eine traumhafte musikalische Reise durch Katalonien, die sowohl auf der kleinen Folkbühne wie im Jazzkeller und im Prog-Rock-Theater Zwischenstation macht. Dabei homogen bleibt und gekonnt zwischen großer Sehnsucht und Laissez-faire kreist.“
Lucinda Williams – „Good Souls Better Angels“. Verlässlich wie immer. Ihre Stimme ist knarziger geworden, die Musik ist es auch. Auf die faszinierende Art.
Anna von Hausswolff – When Thoughts Fly. Kein Gesang, nur Kirchenorgel und diverse andere Tasteninstrumente. Es gibt Menschen, die finden das langweilig. Denen entgeht das rauschhafte Erlebnis einer wahrhaft transzendentalen Nachtmusik.
Domink Scherrer with Natasha Khan (aka Bat For Lashes): „Requiem – O.S.T.“ Die walisische Serie ist ganz okay, der Soundtrack ist eine Wucht. Hier gilt einmal: Atmosphärisch dicht ganz ohne Alkohol. Gilt auch für die Soundtracks zu „The Black Spot“ (im Original völlig konträr: „La Zone Blanche“) „La Foret“ und „Tabula Rasa“, die zwar schon etwas Zeit auf dem Buckel haben, aber jetzt erst von mir richtig entdeckt wurden.
Matt Holubowski: „Weird Ones“. Eine Ode an die Langsamkeit, das nachdenkliche Schlendern in eigentlich hektischen Zeiten.“
Grant-Lee Phillips: „Lightning, Show Us Your Stuff“. Mein Americana-Album des Jahres (dicht gefolgt vom neuen Chuck Prophet-Werk „The Land That Time Forgot“ und der ebenfalls sehr starken kroatischen Band She Brought Me Gasoline). Um es so zu sagen: All das, was Bruce Springsteens lendenlahmes Altherren-Rockwerk „Letter To You “nicht ist.
The Alligator Wine: „Demons Of The Mind“ Ich mag keinen Retro-Rock. The Alligator Wine kommen aus Deutschland und spielen Retro-Rock. Ich liebe das Album und seine Power. Vielleicht weil die Combo näher bei den DOORS als bei Led Zeppelin ist.
Mrs. Kite – „Flickering Lights“. Wohlakzentuierter New Art Rock aus Deutschland mit leichtem Porcupine Tree/Pink Floyd-Touch. Die Dramaturgie stimmt und melodisch ist das traumhaft psychedelisch. Geerdet durch präzise Rhythmik und verspielte wie kernige Gitarrenparts. Lohnender Prog findet sich auch auf dem hochmelodischen und trotzdem nicht sülzigen „Here And Now“ von Poor Genetic Material. Sehr schön auch, dass Martin Griffiths (Beggars Opera), der Vater von Sänger Philipp mit an Bord ist.
White Rose Transmission – „Happiness At Last“. Selten wurde die Dunkelheit zu einem schöneren Kissen als „Happiness At Last“ es aufschüttelt. Ein mitunter tieftrauriges Album, das dennoch trostreich durch diesen coronageschwängerten Herbst lotste. Die Akustukvariante von Adrian Borlands „Winning“ ist traumhaft.
The Psychedelic Furs – „Pray For Rain“. Neben den Pretenders ein Comeback nach Maß. Emotional, wild, wütend und berührend. Richard Butlers Stimme ist immer noch unverkennbar. Und wenn sich das Saxophon aus wallenden Soundwolken nach vorne fräst, weiß man, die Hölle muss noch einen Tag warten.
Paul Roland – „Lair Of The White Worm“. Der Mann ist natürlich gesetzt. Kur z vor Jahresende veröffentlicht Paul Roland ein weiteres seiner ganz besonderen psychedelischen, victorian-space-age-Wunderwerke. Folk, Baroque-Rock, ein geisterhafter Hauch Weltmusik, Velvet Underground treffen auf Donovan und Ian Anderson spielt im Keller von Hill House Flöte. Maskenball in einer gotischen Kathedrale. Melting away.
Idris Ackamoor & The Pyramids – „Shaman!“ Grandioses Alterswerk, eine mitreißende Mischung aus spirituellem Jazz, Psychedelic und Soul. In etwa als würden ausgeschlafene Gong auf Pharoah Sanders treffen.
Die Bücher:
Es waren vergleichsweise wenig dieses Jahr.
Christian Keßler – „Gelb wie die Nacht“. Christian Keßler schreibt mit viel Zuneigung, Herzblut und kenntnisreich über ein Genre, das gerne weiter in den Focus gehievt werden darf. Essentielles Nachschlagewerk, und nicht nur für Fans der messermetzelnden Thrillerkost aus Sigmund Freuds Schattenkabinett lohnend.
Horst Eckert – „Im Namen der Lüge“. Nach seiner Beschäftigung mit dem NSU-Komplex, schreibt Eckert in diesem spannenden Politthriller über die Verflechtungen von Exekutive, Judikative und neofaschistischen Auswüchsen. Spannend und (leider zu) dicht an der Realität.
Willi Achten – „Die wir liebten“. Wunderbares, wichtiges Buch, die Rezension dazu ist hier bei Booknerds zu finden..
Jon Savage – „Sengendes Licht, die Sonne und alles andere: Die Geschichte von Joy Division“. Die Musik, die Stadt, der Tod. Wichtige Wegbegleiter, literarisch ansprechend gewürdigt.
Achim Reichel – „Ich hab das Paradies gesehen”“. Der Mann kann charmant erzählen, und er hat was zu erzählen. Amüsant und erhellend. Für mich einer der wichtigsten (deutschen) Musiker.
Andreas Kollender „Mr. Crane“. Exzellent geschriebene (fiktive) Liebesgeschichte zwischen Wahn und Wirklichkeit. Der tuberkulöse Autor Stephen Crane („Die rote Tapferkeitsmedaille“, ebenfalls von Pendragon neu aufgelegt) und die Krankenschwester Elisabeth begegnen sich in Badenweiler, in dessen Sanatorium der sterbenskranke Mr. Crane in Behandlung ist. Liebe, Paranoia und die Kraft des Erzählens. Je näher der Tod, umso intensiver das Leben.
Guillermo Martinez – „Der Fall Alice im Wunderland“. Der Nachfolger der „Oxford-Morde“ ist wieder ein intelligentes Vexierspiel. Der weiße Hase kennt den Mörder, hat aber keine Zeit, es zu verraten. Der verrückte Hutmacher denkt sich seinen Teil dazu und grinst zufrieden.
Film und Fernsehen
„The Nightingale“ ist eine düstere Rachegeschichte der besonderen Art. Jennifer Kents („The Babadook“) zweiter Langfilm erzählt von strukturellem Rassismus, Misogynie und Gewalt. Die neuseeländische Landschaft ist atemberaubend, die Darsteller*innen sind es auch. Ein Film, der wehtut und das ist auch gut so.
„The Hunt“ wurde bereits vor seinem Erscheinen kontrovers aufgenommen, sodass sich die Veröffentlichung Monat um Monat verzögerte. Die klassische „Dr. Zaroff“-Menschenjagd-Storyline als actionreiche Gesellschaftssatire voller cooler Twists und Widerhaken. Hillary Swank überzeugt, gegen den Strich besetzt (oder doch nicht?), Emma Roberts schaut nur ganz kurz vorbei und Hauptdarstellerin Betty Gilpin (die erst nach 25 Minuten auftaucht) ist ein funkelnder Diamant solitärer Art.
„Spuk in Hill House“ und „Spuk in Bly Manor“. Mike Flanagans serielle Verfilmungen der nicht ganz unbekannten Vorlagen von Shirley Jackson und Henry James gehören zusammen wie Hanni & Nanni. Ein Duo, das zum Besten gehört, was im letzten Jahr über die Mattscheibe flimmerte. Exzellente Bildgestaltung, stimmungsvoller Soundtrack, überzeugende Schauspieler*innen (insbesondere die Kinderdarsteller verdienen besonderes Lob) machen beide Serien zum düsteren Genuss. Liebe, Verlust, Verborgenes und Erahntes, (familiäre) Lügen und Traumata machen große Geistergeschichten, wahren Horror aus. Und nicht ein Übermaß an Jump Scares. Zudem eine packende Reise in die vielen Schichten der Traumdeutung.
„Birds Of Prey – The Emancipation Of Harley Quinn“. So schröcklich die „Suicide Squad“ war, so herrlich die Konzentration auf die einzig sehenswerte Komponente: Die brillierende Harley Quinn. Die sich in „Birds Of Prey“ vom Joker emanzipiert und eine Damenriege in die Oberliga der Superheld*innenfilme führt. In die vordersten Ränge. Und das in einer Zeit, die von einer magenverstimmenden MCU/DC-Übersättigung geprägt ist. Action, Fun und Frauenpower. Margot Robbie kickt sie alle.
„Knives Out“ – Ein Meta-Murder-Mystery mit einer Besetzung zum Niederknien. Voller Twists, hinterhältiger Komik, gegen den Strich-Besetzung und fröhlicher Spannung. Gewitzt wie sonst was, aber nie überheblich.
„Gretel & Hänsel“ – Bildgewaltiger, meditatives Horrormärchen von Anthony Perkins‘ Sohn Osgood. Gerade angesichts der teils gestelzten, betont literarischen Dia- und Monologe, die für einen irritierenden Verfremdungseffekt sorgen (ob bewusst oder nicht ist egal), hervorragend gespielt und mit einem hypnotischen Soundtrack von Rob veredelt. Wie oft in starken Horrorfilmen geht es um erwachende und erstarkende Weiblichkeit, die mit der belastenden Vergangenheit bricht und so das dräuende Grauen bekämpft. Sophia Lillis belegt einmal mehr, dass sie eine der interessantesten Schauspielerinnen einer jungen Garde ist, die weit über „Stranger Things“ und „Es“ hinaus, fast durchweg punkten kann (gerne erinnere ich an die herausragende Kaitlyn Dever in „Unbelievable“).
„The Devil All The Time“ – Die Verfilmung von Donald Ray Pollocks „Das Handwerk des Teufels“ ist ein aschfahler, episodisch aufgebauter Southern Noir, distanziert erzählt, was diese deprimierende Schilderung über dumpfen Glauben, Misogynie, Verführung, Lust und Gewalt, erträglich macht. Die Besetzung ist erlesen, unter anderem trifft die verlockende Elvis-Enkelin Riley Keough (als prollige Femme Fatale mit Gewissen und wenig Glück bei der Wahl ihrer Männer. Wärmstens ans Herz gelegt auch „The Lodge“ von Veronika Franz und Severin Fiala mit Keough in der Hauptrolle) nach „Under The Silver Lake“ auf ihren zweiten Spiderman (geht nicht gut aus), und Sebastian „Winter Soldier“ Stan gibt einen verfetteten, korrupten Cop. Robert Pattinson erhebt Overacting zur Kunstform in einer selten unsympathischen Rolle. Macht er gut. Dem katholischen Filmdienst gefiel „The Devil All The Time“ nicht sonderlich. Aus naheliegenden Gründen. Wir mögen diesen langsamen, aber stetigen Ritt in die Finsternis dafür umso mehr.
Es war also nicht alles schlecht in diesem Jahr voller Einschränkungen und Unwägbarkeiten. Das Schönste: Ich kenne mehr Menschen, die das Leben lebenswerter machen als empathielose Rechtslenker, deren moralischer Kompass noch nie Zeiger besaß (vielleicht ganz früh, dann sind sie aber abgebrochen). Und während Erstere prägend bleiben mögen, gilt für Letztere einmal mehr der fromme Wunsch Archives: „ Now the world needs to see that it’s time you should go – There’s no light in your eyes and your brain is too slow“. Der Trump immerhin hat das Gebäude verlassen. Leider nicht straight to hell. 2021 kann trotzdem kommen.